Von Andrea Vetter
Barbara Muraca und Tanja von Egan-Krieger sprechen in diesem Interview über "Gutes Leben jenseits des Wachstums – Entwürfe und Kritik feministischer Ökonomik". Im fünften und letzten Teil dieses Interviews steht die Frage im Mittelpunkt, warum der asketische "Lonely Hero" mit geringem ökologischen Fußabdruck nicht als Vorbild taugt.
Auf der Tagung der Attac Gender AG "Schneewittchen rechnet ab" am 3. November 2012 arbeiteten über 100 Teilnehmer_innen gemeinsam dazu, was (queer-)feministische Ökonomie leisten kann. Wo stößt sie an Grenzen und wie kann eine sinnvolle Weiterentwicklung gedacht werden? Welche Alternativen der Arbeit und der Produktion gibt es? Und nicht zuletzt: Wie wollen wir leben? Im Anschluss an die Tagung ist eine Publikation mit Artikeln und Interviews der Referent_innen und Künstler_innen erschienen. Aus einem der Gespräche werden an dieser Stelle in loser Folge Teile veröffentlicht.
Andrea Vetter: Ich glaube als Feministin ist es letztlich egal, an welcher Diskussion man sich beteiligt, man muss immer für die feministische Sache kämpfen.
Barbara Muraca: So ist es. Dazu kann ich vielleicht noch anekdotisch etwas aus Venedig erzählen, von der Degrowth-Konferenz 2012. Serge Latouche erwähnt oft lobend die Elfenbeinküste, wo die Menschen angeblich nur sehr wenige Stunden pro Woche arbeiten würden und sehr glücklich seien. Die feministische politische Ökonomin Antonella Picchio, die als Referentin auf einem Podium saß, meinte dazu: Mag wohl sein, dass die Männer wahrscheinlich fünf Stunden die Woche arbeiten, aber sicherlich nicht die Frauen, denn sie müssen sich die ganze Zeit mit Kindern und wahrscheinlich auch mit der Pflege anderer Familienmitglieder beschäftigen! Und das ist eine Arbeit, die sich eben nicht verkürzen lässt.
Sie werden wahrscheinlich auch das Essen zubereiten usw.
BM: Genau, deswegen, das ist eine Arbeit, die immer da ist. Trotzdem gibt es auch bei Kritikern diesen Fokus auf die Erwerbsarbeit. Wenn von Reduzierung gesprochen wird, wird immer von einer Reduzierung der Erwerbsarbeit, von mehr Muße gesprochen. Doch tatsächlich ist der Punkt eine Umverteilung aller gesellschaftlich sinnvollen Tätigkeiten: der so genannten reproduktiven Tätigkeiten und derjenigen, die zur Zeit als produktiv gelten. Das ist eine große Herausforderung, etwas, was wir uns erkämpfen müssen. Genauso wie wir uns gegen radikale Vorstellungen - davon habe ich auch schon gehört - von einer Postwachstumsgesellschaft wehren müssen, die einfach die Abschaffung jeglicher Hilfstechnologie wie die Waschmaschine als Ziel setzen. Dabei denke ich immer, ja, vielleicht muss man nicht soweit kommen, es würde völlig ausreichen, eine Waschmaschine gemeinschaftlich zu nutzen. Aber dieses Solidaritätsmoment wird immer wieder gern vergessen zu Gunsten von individuellen Verzichts-Lebensstilen. Und das ist ganz gefährlich. Deswegen denke ich, der Weg ist tatsächlich Solidarität und Konvivialität. Das ist der Königsweg, aber das ist etwas, das man sich erkämpfen muss, denn gerade dieser Weg ist letztlich viel radikaler. Diese Narrative des „Lonely Hero“ ist auch wieder männlich konnotiert: der Held, der in der Wildnis lebt, sich selbst versorgt, sich selbst die Wunden näht, wie Rambo, und nicht mehr angewiesen ist auf irgendwelche gesellschaftliche Kooperation oder Solidarität - er lebt da auf sich selbst gestellt und hat einen ganz geringen ökologischen Fußabdruck. Und da denke ich, ja, aber das ist genau diese absurd-ideale Vorstellung von isolierten Männern, die offensichtlich nie als hilfsbedürftige Kinder in die Welt geboren wurden und nie altern, sondern schon immer autonom waren, im Sinne von völlig abgeschottet und selbständig. Ich würde sagen, wir müssen Autonomie ganz anders verstehen, wie zum Beispiel in der Autonomietradition der politischen Ökologie in Frankreich. Autonomie heißt tatsächlich: Solidarische Formen von gemeinschaftlich selbst-organisierter Produktion. Autonomie ist ein kollektives Projekt. Es ist kein individuelles Projekt. Wahrlich autonom kann ich nur in einem Kollektiv sein, an dem ich gleichberechtigt teilhaben kann.
Tanja von Egan-Krieger: Wobei das eben auch bedeutet, dass Autonomie auch ein politisches Projekt ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir bei der derzeitigen Organisation unserer Wirtschaft unter enormen Zwängen stehen. Diese Zwänge werden mit der Verschärfung des Wettbewerbsdrucks immer stärker. Eine Postwachstumsgesellschaft können wir deswegen nur erreichen, wenn wir auch auf die Veränderung der politischen Rahmenbedingungen hinwirken.
> Kommentieren Sie diesen Artikel auf dem Blog "Postwachstum"---
Gekürzte Version aus: Christine Rudolf, Doreen Heide, Julia Lemmle, Julia Roßhart, Andrea Vetter (Hg.): "Schneewittchen rechnet ab. Feministische Ökonomie für anderes Leben, Arbeiten und Produzieren", VSA Verlag, 2013. Mehr dazu: http://feministischeoekonomie.wordpress.com/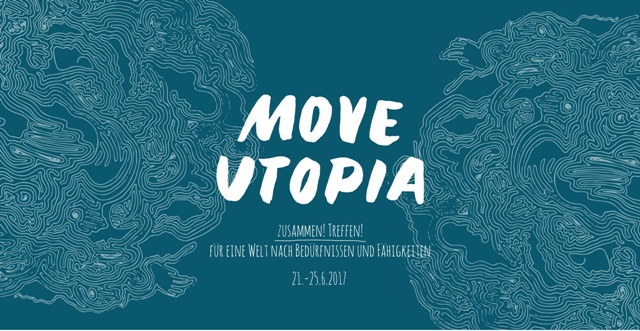
Zusammen!Treffen! für eine Welt nach Bedürfnissen und Fähigkeiten. MOVE heißt: Wir möchten Miteinander Offen Vertrauensvoll Emanzipatorisch ... die Zukunft gestalten! Wir teilen die Vision, überkommene Verhältnisse menschlicher Vereinzelung ab- und neue Formen des Zusammenlebens aufzubauen. Wenn wir Bedürfnisse und Talente offen teilen und mitteilen, kann eine neue Art von Beziehungen entsteh...
In a recently published article in Nature Climate Change, Jeroen van den Bergh argues that neither degrowth nor green-growth strategies might lead to sufficient climate action and hence makes the case for a third option which he calls “agrowth”. While the understanding of degrowth reflected in the article can certainly be disputed – it comes across as mainly targeting a shrinking GDP – his conc...
„Weiter wie bisher“, lautet das Motto der herrschenden Politik, gerade auch in Deutschland. Die dominante öffentliche Diskussion und Politik inszeniert sich als Sachzwang-Politik – Anpassungsleistungen an die angeblich alternativlose Austeritätspolitik sind andernorts zu erbringen. Dass Menschen verarmen, von unten nach oben umverteilt wird und soziale Rechte und Demokratie abgebaut werden, sei nur vorübergehend, wird [...]